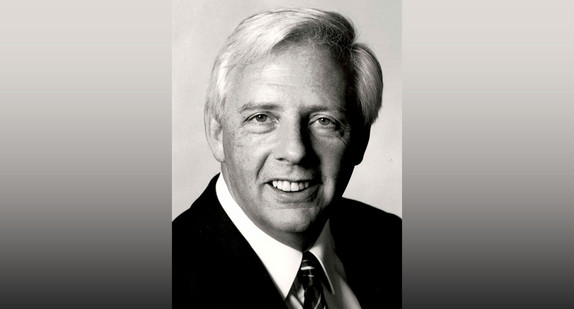Damit Kunstschaffende und Kultureinrichtungen in Baden-Württemberg auch in Zukunft gute Arbeitsbedingungen vorfinden, sorgt das Land für eine transparente Förderung und eine verlässliche Finanzierung – oft in bewährter Partnerschaft mit den Kommunen. Um die soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern zu verbessern, erfolgte eine Erhöhung der Stipendien und Preise des Landes. Es wird angestrebt, freiberufliche Leistungen angemessen zu vergüten. Dabei ist die Förderung aller Kunstformen und der Gesamtheit des künstlerischen Schaffens eine der zentralen Aufgaben der Landespolitik.
Zu einem vitalen Kunst- und Kulturleben gehören neben Exzellenz und herausragenden Leistungen auch Vielfalt und Breite im gesamten Land. Die Breitenkultur als Basis für eine lebendige und ausdifferenzierte Kulturlandschaft genießt deshalb große Beachtung. Denn das oftmals ehrenamtliche Engagement weckt früh das Interesse an künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und schafft Zugänge zu Kunst und Kultur.
Ein wichtiges Anliegen ist die stärkere Öffnung der Kultureinrichtungen für ein breites, diverses Publikum und die Ansprache neuer Publikumskreise. Dazu gehört der Einsatz digitaler Vermittlungsformate und die Entwicklung digitaler Strategien.
Um das kulturelle Leben in den ländlichen Regionen weiterzuentwickeln, ehrenamtlichen Akteuren eine Perspektive zu bieten und auch junge Menschen zu begeistern, braucht es professionelle Strukturen. Vor diesem Hintergrund hat das Kunstministerium gemeinsam mit dem Programm TRAFO der Kulturstiftung des Bundes und der Lernenden Kulturregion Schwäbische Alb das Pilotprojekt „Regionalmanagerin/Regionalmanager Kultur“ erarbeitet. Ziel des Pilotprojektes ist, professionelle Kulturmanagerinnen und -manager auf kommunaler Ebene zu etablieren und die Verantwortungsbereitschaft der Kommunen für die regionale Kulturentwicklung zu stärken.
In den Jahren 2020 bis 2023 wurden acht Regionalmanagerinnen und -manager Kultur in sechs ausgewählten Landkreisen und Regionen gefördert. Nachdem die Landesmittel ausliefen, wurden die Stellen von den Landkreisen und Regionen dauerhaft verstetigt. Ausgehend von den jeweiligen örtlichen Bedürfnissen und Entwicklungspotentialen werden Maßnahmen zur Beratung, Unterstützung und Vernetzung der regionalen Kultur-Akteure entwickelt. Es ist vorgesehen, die Projekte auf weitere Landkreise auszuweiten.
Ein weiterer Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums ist die Konzeption Keltenland Baden-Württemberg. In diesem Rahmen stellt das Land Fördergelder bereit, um bedeutende Keltenfundorte und -museen in Baden-Württemberg zu modernen Erlebniswelten zu entwickeln. Die Mehrzahl dieser Keltenstätten liegt im strukturschwachen, ländlichen Raum. Die Realisierung der Förderprojekte im Rahmen der Keltenkonzeption eröffnet für die einzelnen Regionen touristische und wirtschaftliche Perspektiven.
Mit dem Förderprogramm „FreiRäume“ beteiligte sich das Kunstministerium an dem Impulsprogramm der Landesregierung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es zielte darauf ab, neue Orte der Begegnung und des soziokulturellen Engagements zu schaffen. In Zusammenarbeit verschiedener Akteure wurden leerstehende Gebäude in ländlichen Kommunen durch künstlerische und soziokulturelle Prozesse wiederbelebt oder bestehende Kulturorte für neue Nutzungen geöffnet und zu sogenannten „Dritten Orten“ weiterentwickelt werden.
Das Förderprogramm „FreiRäume“ richtete sich insbesondere an Kommunen und kommunale Verbünde, Kultureinrichtungen und Einrichtungen kultureller Bildung sowie an Vereine und bürgerschaftliche Initiativen. Dafür stellte das Land insgesamt 3 Millionen Euro zur Verfügung. Landesweit wurden 45 Projekte ausgewählt. Es ist angedacht, das Programm weiterzuführen.
Kunst und Kultur leben von Kreativität und Ideen. Sie brauchen Entwicklungsmöglichkeiten, frei von jeglicher Einflussnahme. Damit sich neue Ansätze, Sichtweisen und Konzepte entfalten und neue Impulse entstehen können, fördert das Land mit dem Innovationsfonds Kunst neuartige Ausdrucks- und Beteiligungsformen in verschiedenen Sparten. Seit der Einführung des Innovationsfonds im Jahr 2012 haben über 600 Projekte mit rund 18 Millionen Euro in verschiedensten Förderlinien davon profitiert.
Ein wichtiges Projekt ist die Neuausrichtung des Kunstgebäudes Stuttgart als moderne, innovative und offene Kulturinstitution, die Raum für unterschiedliche kulturelle und mediale Formate sowohl im analogen als auch digitalen Kontext bietet.
Kulturelle Bildung bietet dem Einzelnen die Chance, Kulturangebote zu nutzen und das kulturelle Leben selbst mitzugestalten. Kunst und Kultur für alle Menschen – unabhängig von Alter und Herkunft – zugänglich zu machen, ist deshalb ein wichtiges Anliegen der Landesregierung. Die intensive Zusammenarbeit und Vernetzung von Kultureinrichtungen mit Schulen und anderen Bildungsträgern schaffen die hierfür notwendigen Voraussetzungen. Mit der Einrichtung des Zentrums für Kulturelle Teilhabe Baden-Württemberg hat das Land eine zentrale Einrichtung für Beratungsleistungen und Vernetzung im gesamtem außerschulischen Themenspektrum der kulturellen Bildung sowie für Fragen der Diversität und Vermittlung geschaffen. Es ist im ganzen Land für alle Kunstsparten tätig, zum Beispiel durch Förderprogramme und Vernetzungsformate. Mit seinen Angeboten unterstützt es die nachhaltige gesellschaftliche Öffnung von Kunst- und Kultureinrichtungen hin zu Diversität und kultureller Teilhabe für alle Altersgruppen.
Die beiden Blasmusikakademien in Plochingen und Staufen wurden mit insgesamt 21,3 Millionen Euro für Neubauvorhaben unterstützt. Ein Ziel ist die Stärkung und Qualifizierung der unzähligen ehrenamtlich Engagierten im Bereich der Amateurmusik. Ein weiteres Ziel ist die kulturelle und musikalische Bildung im ganzen Land, besonders von Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Migrationshintergrund.
Kulturelle Vielfalt macht unsere Gesellschaft reicher. Interkulturelle Projekte sind besonders geeignet, um die großen Potenziale zu erschließen, die sich aus dem Zusammenleben von Menschen verschiedener Herkunft und Prägung ergeben. Das Land fördert diesen Veränderungsprozess im kulturellen Bereich. Mit ihrer identitätsstiftenden, dialogfördernden und vermittelnden Wirkung können Kunst und Kultur dazu beitragen, dass sich Menschen mit größerer Offenheit begegnen.
Kulturelle Identität fußt auf historisch Gewachsenem. Die Pflege, Erforschung und Weitergabe unseres reichen kulturellen Erbes an die nachkommenden Generationen ist eine der zentralen Aufgaben von Museen. Mit zusätzlichen Mitteln für die Durchführung von Großen Landesausstellungen und Großen Sonderausstellungen ermöglicht die Landeregierung, dass die Landesmuseen ihre herausragenden Sammlungen und das kulturelle Erbe des Landes einer breiten Öffentlichkeit anschaulich vermitteln können.
Die Landesregierung unterstützt mit der 2022 gegründeten Museumsakademie der Landesstelle für Museen die Kompetenzerweiterung und Weiterqualifikation der wissenschaftlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Museen im Land, die das kulturelle Erbe des Landes bewahren und vermitteln.
Die Erforschung unseres kulturellen Erbes ist eine wichtige Voraussetzung für die kritische Reflexion und den gesellschaftlichen Austausch. Im Rahmen der Provenienzforschung stellt sich das Land der Verantwortung, in der Zeit des Nationalsozialismus unrechtmäßig angeeignete Kunst an die Erben früherer jüdischer Eigentümer zurückzugeben. Das Land setzt die im Jahr 2012 initiierte Unterstützung der staatlichen Museen bei der Klärung dieser Fragen fort. Zur historischen Verantwortung gehört auch ein angemessener Umgang mit Kulturgütern, die in kolonialem Kontext erworben wurden. Das Land geht auch diese Herausforderung aktiv an.
Zur Verantwortung für das kulturelle Erbe gehören auch zahlreiche Bauvorhaben im Bereich der Kultur, allen voran die anstehende Sanierung des Stuttgarter Opernhauses und des Staatstheaters in Karlsruhe. Mit der Sanierung, der baulichen Instandhaltung und teilweise auch dem Neubau wichtiger Kulturbauten schafft das Land die Voraussetzung dafür, dass seine Kultureinrichtungen auch in Zukunft den Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft gewachsen bleiben.
Mit der Strategie „Kultur digital erleben“ im Rahmen von digital@bw, der Digitalisierungsstrategie des Landes, wurde die Vermittlung von Kulturgut in allen Landeseinrichtungen gefördert. Hier wurde berücksichtigt, dass technologische und gesellschaftliche Entwicklungen im Zuge der Digitalisierung auch die Arbeit von Künstlerinnen, Künstlern und Kultureinrichtungen verändern. Es war außerdem wichtig, dass Digitalisierung die künstlerischen Ausdrucksformen erweitert, neue Perspektiven in Präsentation und Vermittlung eröffnet und neue Möglichkeiten für die kulturelle Teilhabe bietet. Damit unterstützt das Land die Kultureinrichtungen dabei, die Chancen zu nutzen, die sich hieraus bieten. Mit der weiterentwickelten Digitalisierungsstrategie digital.LÄND hat sich das Land im Herbst 2022 zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit von Kulturdaten zu erhöhen, die innovative digitale Präsentation der Kultureinrichtungen zu stärken und digitale Kulturgüter auch in der Breite nutzbarer machen.
Mit den Förderprogrammen Digitale Wege ins Museum I und II hat die Landesregierung von 2017 bis 2020 die Digitalisierung der Landesmuseen und des Zentrums für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) mit innovativen Konzepten zur digitalen Vermittlung von Kunst und Kultur gefördert. Zusätzlich wurden 20 neue unbefristete Stellen für Digitalexpertinnen und -experten in den Landesmuseen und am ZKM geschaffen, um digitales Fachpersonal einzustellen und den Häusern langfristige Entwicklungsmöglichkeiten und Verlässlichkeit beim Aufbau digitalen Knowhows zu garantieren.
Gemeinsam mit der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) fördert das Land darüber hinaus konkrete Projekte und Umsetzungsvorhaben für die digitale Transformation der nichtstaatlicher Museen im Land. Nichtstaatliche Museen haben vor allem durch die Coaching-Programme „Museen im Wandel I & II & III“ von 2018 bis 2023 Unterstützung erhalten. Das digitale Format "Museumscafé" oder seit dem Jahr 2021 die "Digitalwerkstatt" richten sich besonders an kleinere und mittlere Museen.
Baden-Württemberg hat eine breite und dynamische Film- und Kreativszene und gilt seit vielen Jahren als Deutschlands Top Standort im Bereich Animation und Visuelle Effekte. Im Netzwerk der Animation Media Creators Stuttgart haben sich mehr als 35 VFX-Dienstleister, Animationsstudios, Games- und Interactive-Studios als auch Hochschulen und Akademien zusammengeschlossen.
Die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG) fördert kulturell herausragende Produktionen für Kino und Fernsehen – vom Drehbuch über die Produktion bis zum Filmverleih und den Filmtheatern. Die Line Producer Förderung der MFG wurde speziell für die Produktion von Filmen und Serien entwickelt, die animiert werden oder virtuelle Dreharbeiten und visuelle Effekte aufweisen. Außerdem hat die MFG Baden-Württemberg ihre Games-Strategie mit der Einrichtung von GamesHubs und der Schaffung von gezielten Fortbildungsmaßnahmen und Projektförderungen für Studierende, Start-Ups sowie kleine und mittlere Unternehmen fortentwickelt. Eine bundesweite Vorreiterrolle hat die MFG mit der Green-Shooting-Initiative für möglichst ressourcenschonende Produktionsmethoden als Förderkriterium in der Filmherstellung und den Vorgaben zur Einhaltung von sozialen Standards bei Filmvorhaben eingenommen.
Baden-Württemberg zeichnet sich außerdem durch eine reiche und ambitionierte Kinolandschaft aus – auch außerhalb der Ballungsräume und im ländlichen Raum. Das wird durch eine starke Kinoförderung der MFG unterstützt. Außerdem finden viele Filmfestivals und international bekannte Branchenveranstaltungen in Baden-Württemberg statt. Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart sowie die FMX zählen dabei international zu den wichtigsten Veranstaltungen zu Animation und digitalen Medien. Im Bereich der Filmausbildung gehört das Land unter anderem mit der Filmakademie Baden-Württemberg und ihrem Animationsinstitut zur Weltspitze.
In den kommenden Jahren wird es vor allem um die Frage gehen, wie Künstliche Intelligenz (KI) in der Film- und Medienbranche den technologischen Fortschritt weiter vorbringen und kreative Leistungen fördern kann. Zahlreiche Einrichtungen in Baden-Württemberg bringen diese neuen Technologien bereits in Ausbildung, Forschung, Entwicklung und Produktion zum Einsatz.
Popkultur und Popmusik sind mehr als nur Unterhaltung. Pop ist das Ausdrucksmittel der jeweils nächsten Generation und inzwischen auch generationenübergreifend ein wichtiger Teil des kulturellen Lebens. Durch ihre künstlerische Vielfalt, soziale Relevanz, wirtschaftliche Bedeutung und Innovationskraft leistet die Popkultur einen unverzichtbaren Beitrag zur kulturellen und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes.
Die zentralen Standbeine der Popförderung in Baden-Württemberg bilden die Bereiche Film, Games und Popmusik. Vor allem im Bereich der Popmusik hat Baden-Württemberg durch seine bisherige Förderstrategie im Ländervergleich historisch Pionierarbeit geleistet.
Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 ist die Popakademie Baden-Württemberg als staatliche Hochschuleinrichtung für Populäre Musik und Musikwirtschaft bis heute einzigartig in Deutschland und darüber hinaus. Sie bietet drei Bachelor- und zwei Masterstudiengänge, darunter den in Deutschland einzigartigen Bachelorstudiengang Weltmusik. Zusätzlich zu ihrer Funktion als Ausbildungsstätte wirkt die Popakademie Baden-Württemberg als Kompetenzzentrum für Popkultur und Musikwirtschaft in das ganze Land hinein und realisiert Projekte im regionalen, nationalen und internationalen Zusammenhang wie Bandpool, Future Music Camp, Konferenz Zukunft Pop, SMIX.LAB oder Vermittlung Populäre Musik. Sie verfügt über ein weltweites Partnernetzwerk und pflegt Kooperationen mit vielen internationalen Hochschulen und Institutionen.
Mithilfe des RegioNet-Programms, das an der Popakademie angesiedelt ist, wurde eine bislang einmalige regionale Infrastruktur für Popmusikschaffende im ganzen Land etabliert. Lokale Popzentren, die sich zu den Popbüros Baden-Württemberg zusammengeschlossen haben, dienen als Ansprechpartner, Beratungsstellen und Unterstützer von lokalen Musikschaffenden und Veranstaltenden. Besonders gut aufgestellt, vor allem durch die Partnerschaft mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart, ist das Pop-Büro Region Stuttgart. Es veranstaltet zum Beispiel seit 2019 die jährliche Festival-Convention About Pop, die sich zum größten Hybrid aus Branchentreffen und Club- und Showcase-Festival in Süddeutschland entwickelt hat und vom Land gefördert wird.
Die Corona-Pandemie traf Popmusikerinnen und -musiker sowie Veranstalterinnen und Veranstalter hart. Um die Krise zu bewältigen, legte das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst das Förderprogramm Perspektive Pop auf, das popmusikalische Projekte förderte, die neue künstlerische Impulse setzten und neue Spielorte erschlossen.
Aktuell wird die Popförderung des Landes weitergeschrieben. Grundlage dafür ist der Dialog Popkultur Baden-Württemberg, der von Mai 2023 bis Mai 2024 vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst konzipiert und durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses partizipativen Strategieprozesses unter dem Stichwort POPLÄND entwickelten über 400 Branchenangehörige Empfehlungen für eine zeitgemäße Popförderung. Dabei werden die aktuellen Bedarfe ebenso wie die zukünftigen Entwicklungen in den Blick genommen. Die neuen kulturpolitischen Leitlinien für die Popkultur werden Ende 2024 veröffentlicht. Die Umsetzung der kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen erfolgt anschließend in Anhängigkeit von der Mittelbereitstellung im Haushalt durch den Landtag.