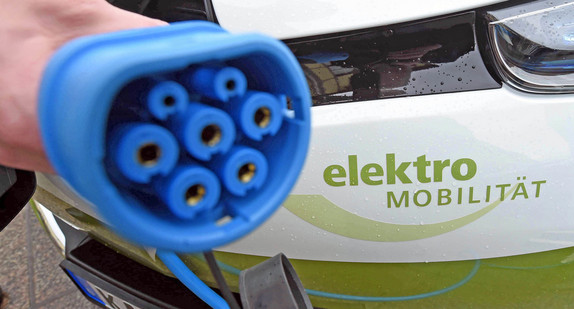Die Schwörtagstraditionen in ehemaligen Reichsstädten und der Streuobstanbau sind in das nationale Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Beide prägen das Selbstverständnis des Südwestens als Kulturland und tragen zur Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutschland bei.
Die „Schwörtagstraditionen in ehemaligen Reichsstädten“ und der „Streuobstanbau“ sind durch Beschluss der Kulturministerkonferenz in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. „Das Immaterielle Kulturerbe steht für unsere lebendige Alltagskultur. Die Bewahrung dieses Erbes trägt dazu bei, dass gelebte Traditionen fortgeführt und weiterentwickelt werden. Sie prägen das Selbstverständnis des deutschen Südwestens als Kulturland maßgeblich mit“, sagte Kunststaatssekretärin Petra Olschowski anlässlich der Aufnahme der beiden Einträge aus Baden-Württemberg in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes. Der Eintrag als Immaterielles Kulturerbe stärke das öffentliche Bewusstsein für diese Traditionen – gerade auch für künftige Generationen.
„Dem Streuobstanbau kommt als Kulturform mit einem breiten Repertoire an traditionellen Praktiken und Wissen, das auch immer wieder neue Einflüsse aufnimmt, große Bedeutung zu“, betonte Olschowski. Mit mehr als 100.000 Hektar Streuobstwiesen verfüge Baden-Württemberg zudem europaweit über die bedeutendsten Streuobstbestände. „Mit rund 5.000 Tier- und Pflanzenarten zählen sie zu den artenreichsten Lebensräumen in Mitteleuropa und sind wertvolles Gen-Reservoir für rund 3.000 Obstsorten. Streuobstwiesen sind auch touristisch attraktive Kulturlandschaften, die das baden-württembergische Landschaftsbild prägen“, sagte Olschowski.
Zur Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutschland tragen auch die Schwörtage bei, so die Staatssekretärin weiter: „Die Schwörtage sind Ausdruck eines demokratischen urbanen Geistes. Sie sind nicht nur kulturelles Gedächtnis der Städte, sondern bis heute ein sichtbares Zeichen bürgerschaftlichen Gemeinsinns und zivilgesellschaftlichen Engagements“, betonte Olschowski. Der Streuobstanbau wie auch die Tradition der Schwörtage würden zur Vielfalt des kulturellen Lebens Deutschland beitragen.
Der Streuobstanbau ist eine länderübergreifende Kulturform, deren Wert vor allem im Wissen und Weitergeben und in traditionellen Anbau- und Bewirtschaftungstechniken, weniger in gesellschaftlichen Bräuchen liegt. Hier wird vom Baumschnitt bis zum Mostrezept ein breites Repertoire an traditionellen Praktiken und Wissen eingesetzt und weitergegeben. Beim Streuobstanbau handelt es sich um ein weit über Deutschland hinausreichendes, länderübergreifendes Kulturphänomen.
Die Schwörtagstraditionen gehen auf eine bis ins Mittelalter zurückreichende Verfassungstradition zurück, die für die genannten reichsunabhängigen Stadtstaaten jahrhundertelang typisch war und nach 1945 als Ausdruck demokratischen urbanen Geistes wieder zum Leben erwachte.
Neben den Schwörtagstraditionen und dem Streuobstanbau wurden sechzehn weitere lebendige Traditionen ins bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulterbes aufgenommen. Das hat die Kulturministerkonferenz gemeinsam mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien beschlossen. Zudem wurden zwei Modellprogramme der Bau- und Erzählkunst gewürdigt. Sie zeigen beispielhaft, wie Immaterielles Kulturerbe erhalten werden kann. Damit zeugen nun insgesamt 126 Einträge im Bundesweiten Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes von der Vielfalt des kulturellen Lebens in Deutschland.
Jury und Verfahren
Die Jury, bestehend aus unabhängigen Sachverständigen des Landes, bewertete die Bewerbungen nach den Kriterien „hinreichend belegtes Alter und entsprechende Tradition als kulturelles Erbe“, „herausragende kulturelle bzw. kulturgeschichtliche Bedeutung“, „ehrenamtliches Engagement der Funktionsträger und Organisatoren ohne Gewinnerzielungsabsicht“ sowie „Regionaltypik und identitätsstiftende Wirkung für einen bestimmten geographischen Raum“. Mitglieder der Jury waren die Akademische Rätin Dr. Karin Bürkert vom Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen, Prof. Dr. Werner Mezger vom Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg sowie Dr. Markus Speidel, Leiter der Fachabteilung Populär- und Alltagskultur im Landesmuseum Württemberg.
Immaterielles Kulturerbe
Deutschland ist seit 2013 der 153. Vertragsstaat des UNESCO-Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes. Das Übereinkommen fördert und erhält in allen Weltregionen überliefertes Wissen, Können und Alltagskulturen. Zum Immateriellen Kulturerbe zählen unter anderem Tanz, Theater, Musik, mündliche Überlieferungen, Naturheilkunde und Handwerkstechniken.
Einzelne Elemente aus den nationalen Verzeichnissen der Vertragsstaaten können für eine von drei internationalen UNESCO-Listen des Immateriellen Kulturerbes vorgeschlagen werden. Dazu gehören etwa die Saunakultur in Finnland und der Reggae aus Jamaika. Im vergangenen Jahr wurde das Bauhüttenwesen auf Vorschlag von Frankreich, Norwegen, Österreich, der Schweiz und Deutschland in das internationale UNESCO-Register zum Erhalt Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.