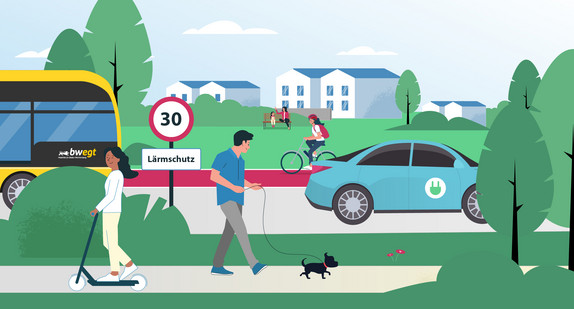Wenn es brennt, retten Rauchmelder Leben. Deshalb sind die Warngeräte künftig in Baden-Württemberg Pflicht. Das hat der Landtag beschlossen.
Jährlich sterben rund 600 Menschen in Deutschland bei Bränden, die Mehrzahl von ihnen in Privathaushalten. Die meisten von ihnen werden nachts im Schlaf vom Feuer überrascht. Im Schlaf bemerken sie nicht, dass ein Feuer ausgebrochen ist. 95 Prozent der Brandtoten fallen nicht den Flammen zum Opfer, sondern sterben an einer Rauchvergiftung. Schon nach zwei bis vier Minuten können die inhalierten Brandgase tödlich sein.
Viele dieser Opfer könnten vermieden werden, wenn Wohnungen mit Rauchmeldern ausgestattet wären. Denn Rauchmelder lösen schnell nach Ausbruch eines Brandes Alarm aus und warnen mit einem schrillen lauten Ton vor der tödlichen Gefahr.
Deshalb haben wir nun auch in Baden-Württemberg die Rauchmelderpflicht eingeführt. Der Landtag hat eine entsprechende Änderung der Landesbauordnung beschlossen.
Häufige Fragen und Antworten zur Rauchwarnmelderpflicht
Ab wann gilt die Rauchmelderpflicht?
Das Gesetz wurde am 22. Juli 2013 im Gesetzblatt verkündet. Damit gilt die Verpflichtung, wenn die Baugenehmigung nach diesem Tag erteilt wurde. Soweit keine Baugenehmigung erteilt wurde, etwa bei Bauvorhaben im Kenntnisgabeverfahren, gilt die Verpflichtung, wenn das Gebäude bis zu diesem Tag noch nicht bezugsfertig war. Alle anderen Gebäude gelten als bestehende Gebäude.
Eigentümerinnen und Eigentümer bestehender Gebäude gibt es eine Übergangsfrist. Sie sind verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2014 entsprechend mit Rauchmeldern auszustatten.
Wer ist für Einbau und Betriebsbereitschaft verantwortlich?
Der Einbau der Rauchwarnmelder obliegt den Bauherrinnen und Bauherren. Bei bestehenden Gebäuden sind die Eigentümerinnen und Eigentümer für den Einbau verantwortlich. Die Verpflichtung der Eigentümerinnen und Eigentümer erstreckt sich gegebenfalls auch auf den Austausch nicht mehr funktionstüchtiger Rauchwarnmelder durch neue Geräte. Der Einbau von Rauchwarnmeldern ist verfahrensfrei.
Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung selbst. Bei Mietwohnungen liegt es also in der Regel in der Verantwortung der Mieterin oder des Mieters als Wohnungsbesitzerin oder -besitzer, zum Beispiel einen Batteriewechsel an den Rauchwarnmeldern rechtzeitig durchzuführen. Besondere behördliche Überprüfungen des Einbaus, die über die allgemeine Bauaufsicht hinausgehen, sowie wiederkehrende Kontrollen sind nicht vorgesehen. Es liegt in der Verantwortung der jeweiligen Verpflichteten, für die Installation sowie für die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder Sorge zu tragen.
In welchen Räumen müssen Melder installiert werden?
Alle Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie Rettungswege von solchen Aufenthaltsräumen in derselben Nutzungseinheit (z.B. Flure und Treppen innerhalb von Wohnungen) sind jeweils mit mindestens einem Rauchwarnmelder auszustatten. Solche Aufenthaltsräume finden sich als Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Gästezimmer insbesondere in Wohnungen, aber auch in anderen Gebäuden, wie z.B. in Gasthöfen und Hotels, Gemeinschaftsunterkünften, Heimen oder Kliniken.
In welcher Weise müssen Melder installiert werden?
Die Rauchwarnmelder müssen so eingebaut oder angebracht werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet wird. Genaue Angaben zur Standortwahl, Montage und Wartung sind in den Herstelleranweisungen enthalten, die zusammen mit den Rauchwarnmeldern geliefert werden. Nach diesen Anleitungen können Rauchwarnmelder einfach mit Schrauben, Dübeln oder Spezialklebstoff montiert werden. Dabei müssen die Informationen der Herstellerfirmen auch den Mieterinnen und Mietern bereitgestellt werden, damit sie die erforderliche Inspektion der Rauchwarnmelder und die Funktionsprüfung der Warnsignale sowie gegebenenfalls den Austausch der Batterien durchführen können.
Wer montiert und wartet die Rauchwarnmelder?
Hinweise auf Montage- und Wartungsarbeiten von Rauchwarnmeldern sind regelmäßig in den Bedienungsanleitungen der Hersteller enthalten. Einschränkungen durch ergänzende Regelungen der Landesbauordnung gibt es nicht. Die Norm DIN 14676, welche die Mindestanforderungen für die Planung, den Einbau, den Betrieb und die Instandhaltung von Rauchwarnmeldern in Wohnungen regelt, wurde nicht in der Liste der technischen Baubestimmungen bekanntgemacht und ist deshalb baurechtlich nicht bindend. Insofern liegt es in der Entscheidung der Eigentümerin oder des Eigentümers, der Empfehlung in DIN 14676 zu folgen und einen zertifizierten Fachdienstleiter mit der Montage und Wartung der Rauchwarnmelder zu beauftragen.
Wer trägt die Kosten?
Diese Frage ist mietrechtlich zu klären. Auskünfte hierzu können bei einem Rechtsanwalt oder bei einer Rechtsberatungsstelle eingeholt werden.
Welche Eigenschaften müssen die Melder haben?
Rauchwarnmelder werden nach DIN EN 14604 in Verkehr gebracht und tragen ein entsprechendes CE-Zeichen.
Dürfen bereits installierte Melder weiter benutzt werden?
Bereits vorhandene Rauchwarnmelder dürfen grundsätzlich weiter benutzt werden. Sofern eine Mieterin oder ein Mieter schon Rauchwarnmelder installiert hatte, sollte sich die Eigentümerin oder der Eigentümer von der ordnungsgemäßen Ausstattung bzw. Installation und Betriebsbereitschaft überzeugen und dies dokumentieren. Allerdings ist die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht verpflichtet, bereits vorhandene Melder weiter zu verwenden.
Sind in den Aufenthaltsräumen bereits geeignete Brandmelde- oder Alarmierungsanlagen vorhanden, kann auf eine zusätzliche Installation von Rauchwarnmeldern verzichtet werden.
Müssen Rauchwarnmelder vernetzt werden?
Nein. Bei sehr großen Nutzungseinheiten kann eine Vernetzung der Rauchwarnmelder innerhalb einer Nutzungseinheit sinnvoll sein, gefordert ist sie jedoch nicht.
Muss die Betriebsbereitschaft auch bei Abwesenheit gewährleistet sein?
Der Rauchwarnmelder soll ausschließlich Menschen warnen, die sich in der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit (Wohnung) aufhalten. Rauchwarnmelder sind weder geeignet, noch dazu bestimmt, Sachwerte zu schützen oder einer Brandausbreitung vorzubeugen. Wenn sich keine Menschen in dieser Nutzungseinheit aufhalten, darf die Betriebsbereitschaft sogar für diesen Zeitraum (z.B. Urlaub) unterbrochen werden; dies kommt jedoch nur in Betracht, wenn es technisch möglich ist und nicht die Eigentümerin oder der Eigentümer die Verpflichtung zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft übernommen hat.
Was passiert, wenn Verpflichtungen nicht eingehalten werden?
Alle Personen, die ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, verhalten sich rechtswidrig, ein Bußgeld ist allerdings nicht vorgesehen.
Wer kommt für die Kosten eines Fehlalarms auf?
Da Rauchwarnmelder nur in dem Raum alarmieren, in dem sie installiert sind, erfolgt die Alarmierung der Feuerwehr in der Regel durch eine Person, die das Signal eines Rauchwarnmelders wahrnimmt. Die alarmierende Person ist nur dann kostenersatzpflichtig, wenn ihr für die Fehlalarmierung Vorsatz oder grob fahrlässige Unkenntnis der Tatsachen vorgeworfen werden kann.
Wer kommt für die eventuellen Schäden auf?
Die vom Technischen Einsatzleiter der Feuerwehr angeordneten Maßnahmen sind vom Eigentümer und Besitzer bzw. Eigentümerin und Besitzerin des betroffenen Grundstücks zu dulden. Hierzu gehört auch die Beschädigung von Türen oder anderen Gebäudeteilen, wenn die Feuerwehr bei einer Alarmierung davon ausgehen durfte, dass eine Gefahr vorlag. Ein Schadensersatzanspruch gegenüber der Gemeinde als Trägerin der Feuerwehr besteht nicht.
Hinweis zu Wohnungseigentümergemeinschaften
Paragraf 15 Absatz 7 der Landesbauordnung (LBO) verlangt den Einbau von Rauchwarnmeldern nur für Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen, sowie für Rettungswege innerhalb der Nutzungseinheiten. Diese Bereiche liegen regelmäßig im Bereich des Sondereigentums. Die Verpflichtung zur Ausstattung von Räumen mit Rauchwarnmeldern nach Paragraf 15 Absatz 7 LBO trifft baurechtlich auch bei Eigentumswohnungen damit allein die einzelne Wohnungseigentümerin oder den einzelnen Wohnungseigentümer und nicht etwa die Eigentümergemeinschaft.
Die Umsetzung der Rauchwarnmelderpflicht nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg durch die Wohnungseigentümerin oder den Wohnungseigentümer verlangt daher keinen Beschluss der Wohnungseigentümergemeinschaft.
Gibt es Rauchwarnmelder für Menschen mit Gehöreinschränkungen?
Für Menschen mit Gehöreinschränkungen gibt es Rauchwarnmelder, die mit Blitzeinrichtungen und Rüttelkissen verbunden werden. Das Gesetz schreibt jedoch nur einen Mindestschutz durch die Eigentümerin oder den Eigentümer mit herkömmlichen batteriebetriebenen Rauchwarnmeldern nach DIN EN 14604 vor. Zur Anbringung solch technischer Zusatzausstattung für gehörlose oder hörgeschädigte Mieterinnen oder Mieter ist die Eigentümerin oder der Eigentümer nicht verpflichtet, der Einbau ist jedoch zu dulden.
Ergänzende Hinweise und Empfehlungen
Rauchwarnmelder können über Netzstrom oder mit Batterie betrieben werden. Bei Geräten mit Batteriebetrieb ist zu unterscheiden zwischen solchen, die mit handelsüblichen Batterien betrieben werden, die von der Benutzerin oder vom Benutzer auszuwechseln sind, und solchen mit fest eingebauten Langzeitbatterien; letztere müssen bei leeren Batterien komplett ausgetauscht werden. Bei allen Betriebsarten sollte jedenfalls das von der Herstellerfirma empfohlene Datum für den Austausch der Geräte beachtet werden, da die Zuverlässigkeit durch Verschmutzung des optischen oder photoelektrischen Systems sowie durch Alterung der Bauteile nach etwa zehn Jahren sinkt.